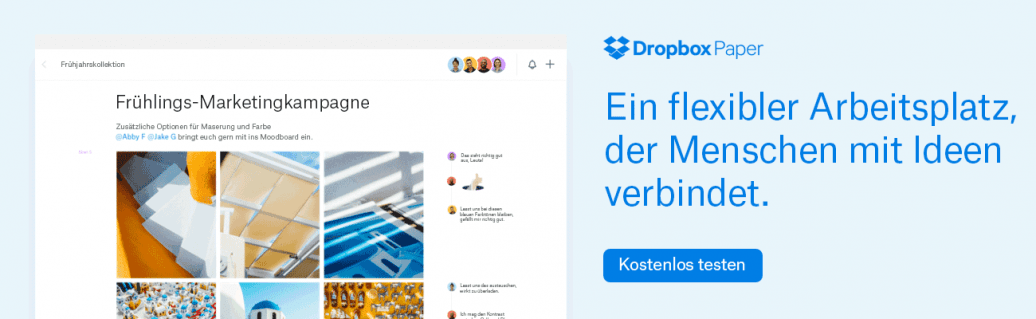Im Interview mit Passenger: Songwriter, Träumer, Kollege

Vor fünf Jahren hat sich das Leben von Mike Rosenberg radikal geändert, als er unter dem Künstlernamen Passenger den Top-Hit „Let Her Go” veröffentlicht hat. Der Song wurde mehr als 1,5 Milliarden Mal auf YouTube angeklickt. Wir haben den talentierten Künstler in Dublin getroffen, wo das letzte Konzert seiner diesjährigen Tour stattfand, und haben mit ihm über die aufregenden vergangenen Jahre, seine kreativen Impulse und das neue, überraschend erschienene Album The Boy Who Cried Wolf gesprochen.
Fünf Jahre sind seit der Veröffentlichung eines ganz bestimmten Megahits vergangen– ein enormer Einschnitt in Ihrem Leben.
Genau. Seit fünf Jahren läuft „Let Her Go“ schon auf YouTube und es ist verrückt, was seitdem alles passiert ist. Seit der Veröffentlichung habe ich ein Konzert nach dem anderen gegeben und, man kann es kaum glauben, heute werde ich dann tatsächlich meinen vorerst letzten Auftritt haben. Ich war fünf Jahre unterwegs und habe vier Alben aufgenommen und 418 Konzerte gegeben – abgesehen von den ganzen Auftritten auf der Straße oder in den Radiosendungen. Wenn man die Straßenmusik miteinschließt, waren es insgesamt bestimmt fast 1.000 Gigs.
Und jetzt brauchen Sie erst einmal eine Pause.
Die brauche ich wirklich. Mein persönlicher Akku ist geradeso noch zu 1 % voll. Vergangene Woche waren es noch 10 % und ich da dachte mir: „Langsam sollte ich wirklich mal das Ladegerät anschließen.“ Habe ich aber nicht, stattdessen habe ich obendrein noch die Taschenlampe benutzt und damit die Batterie zusätzlich belastet.
Fünf Jahre lang hatten Sie also keine Pause und haben vier Alben herausgebracht. Wie haben Sie das überlebt? Wir wissen ja, dass Ihre Kraftreserven gerade aufgebraucht sind.
Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Da war eine Art brennender Wunsch in mir. Passenger hat als Band begonnen, wir haben ein Album veröffentlicht und sind ein wenig umher getourt. Das war um das Jahr 2000 herum. Und aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt. Mein damaliger Manager hat uns verlassen, die Band hat sich aufgelöst und ich wusste damals einfach nicht, was ich tun sollte. Irgendwann danach bin ich dann nach Australien geflogen, wo ich zusammen mit einem Freund aufgetreten bin. Das war mein erstes Konzert ohne die Band.
Da ist mir erst bewusst geworden, dass ich auch alleine auftreten kann. Und dass ich das Publikum unterhalten kann, ohne dass jemand einschläft oder mittendrin nach Hause geht. Kurze Zeit später habe ich dann mit der Straßenmusik angefangen und habe mich dabei voll ins Zeug gelegt. Meine Arbeitseinstellung hat sich dabei total verändert, da ich nun wusste, was ich will und was ich dafür tun muss. Ich glaube, dass talentierte Leute sich oft zu früh auf ihren Lorbeeren ausruhen und nach einem ersten Erfolg denken, dass ihnen alles in den Schoß fallen wird. Aber das ist ein Trugschluss, man muss verdammt hart arbeiten, um erfolgreich zu sein und auch zu bleiben.
Erzählen Sie uns doch etwas mehr über Ihre Arbeitseinstellung
Ich war wie besessen. Straßenmusik machen, sein eigener Boss zu sein und für sich selbst Verantwortung zu übernehmen – das ist einfach mein Ding! Man fährt in unbekannte Städte, bleibt ein paar Tage dort und spielt. Manchmal verkauft man ein paar Hundert CDs, mal hat man einen Auftritt in einem Pub. Das war einfach großartig, besonders nachdem ich die andere Seite der Musikindustrie kennengelernt hatte, die Arbeit mit Musiklabels. Da konnte ich nicht wirklich ich selbst sein, was sehr frustrierend war. Und als ich das hinter mir ließ, auf die Straße zurückkehrte und plötzlich wieder direktes Feedback von echten Menschen bekam, war das sehr befreiend. Und seitdem war es eine absolute Achterbahnfahrt, ganz besonders nach „Let Her Go“. Seitdem ist alles einfach nur total verrückt.
Was denken Sie, warum hatte der Song einen so durchschlagenden Erfolg?
Ich denke, es war einfach Timing. Ich habe viele Shows mit Ed Sheeran gespielt und stand plötzlich jeden Abend vor Tausenden von Menschen. Das war kurz nachdem ich das Album All The Little Lights veröffentlicht hatte. Und „Let Her Go“ schien das richtige Lied zu diesem Zeitpunkt zu sein. Es war eine gute, sehr kommerzielle Werbung für das, was ich tue. Damit etwas so groß werden kann, müssen viele kleine Dinge zusammenkommen. Ich glaube die Sterne standen einfach gut, ja, das Universum hatte ganz sicher seine Hände im Spiel.
Manchmal habe ich richtig gute Tage und schreibe drei oder vier Lieder in einer Woche. Und manchmal vergehen Monate, in denen ich meine Gitarre nicht einmal ansehe. Man muss einfach geduldig sein und sich damit abfinden, wenn es gerade mal nicht so gut läuft.
Ich bin so dankbar und kann es immer noch nicht richtig fassen. Nachdem sich die Band aufgelöst und ich mit der Straßenmusik begonnen hatte, da war mir eigentlich klar, dass meine Musik es nie in die Charts schaffen würde. Ich wusste, ich würde mir niemals diesen Teenietraum von einer Karriere erfüllen können, mit Limousinen herumfahren und dergleichen. Ich dachte, es wird einfach so bleiben: harte Arbeit, Pubauftritte und der Versuch, einen Menschen nach dem anderen von der eigenen Musik zu überzeugen. Und das war okay für mich. Ich war glücklich, denn mein Leben als Straßenmusiker war authentisch, echt, man konnte es sehen und greifen. Ich war wirklich zufrieden. Und dann wurde einer meiner Songs plötzlich zu einem der größten Hits der letzten Jahre. Das wirkte auf mich fast lächerlich als ob ich im Lotto gewonnen hätte.
Das ist wirklich großartig. Aber offensichtlich hat der ganze Erfolg Ihre Arbeitsmoral nicht getrübt. Wenn Sie kreativ sein möchten, folgen Sie da einem bestimmten Prozess?
Ich versuche mir dabei nicht zu viele Regeln aufzustellen. Lieder können auf ganz unterschiedliche Art und Weise entstehen. Manchmal habe ich richtig gute Tage und schreibe drei oder vier Lieder in einer Woche. Und manchmal vergehen Monate, in denen ich meine Gitarre nicht einmal ansehe. Dann habe ich keine Ideen, nichts hat Hand und Fuß, und dann muss man geduldig sein und sich damit abfinden, wenn es gerade mal nicht so gut läuft.
Ich habe wirklich Glück, denn Musik zu schreiben geht mir relativ leicht von der Hand, sodass ich mir selbst meist ein Album voraus bin. So war das schon immer. Wenn ich ein Album aufgenommen habe und es herausbringe, dann habe ich das nächste fast fertig. Das ist einfach praktisch, denn so komme ich eigentlich niemals in die Bredouille, unbedingt ein neues Album unter Druck produzieren zu müssen. Wenn Musiker aus Panik versuchen, sich schnell zwölf Lieder aus den Fingern zu saugen, geht das oft nach hinten los und das sieht man dann an der schlechten Qualität des Albums.
Das ist so eine typische „Zweites-Album-Situation“: ein Musiker hat das ganze Leben Zeit, um seine erste Platte zu schreiben und muss dann innerhalb von sechs Monaten eine zweites aus dem Hut zaubern. „Let Her Go“ ist auf meinem fünften Album, meine Fans hatte also eine Weile Zeit, sich auf meine Musik einzustellen. Als meine zweijährige „Let Her Go“-Tour vorbei war, hatte ich Whispers One und Two schon fertig. Das macht so einiges leichter, schließlich fühlt man sich nicht so unter Druck gesetzt. Für mich ist Songwriting ein Geschenk, kein Zwang. Es ist einfach ein gutes Gefühl, denn man kann den rationalen Teil des Gehirns einfach mal abschalten und dem kreativen freien Lauf lassen.
Wenn man mit anderen zusammenarbeitet, muss man auch loslassen können. Man darf nicht die Kontrolle an sich reißen und muss darauf vertrauen, dass die anderen ihre Arbeit gut machen werden. Das hilft mir, mich auf das zu konzentrieren, was ich selbst tue.
Sie haben vorhin die Auflösung der Band erwähnt. Jetzt spielen Sie wieder mit einer Band. Wie würden Sie die Soloerfahrung mit dem Zusammenspiel als Band auf der Bühne vergleichen?
Das ist eine völlig andere Dynamik. Ich war 20 Jahre alt, als ich das erste Mal in einer Band gespielt habe. Ich hatte damals noch keine wirkliche Vision, ich wusste noch nicht genug über Musik und über mich selbst – darüber, was ich eigentlich machen wollte. Wir hatten ein paar erfahrenere, ältere Bandmitglieder, die dann die Führungsrolle übernommen haben. Rückblickend war das wohl nicht der richtige Weg, denn damit ein Projekt wirklich funktionieren kann, muss derjenige, der vorne steht und singt, wirklich hinter den Texten stehen.
Wie bringen Sie Ihre Bandmitglieder dazu, Ihre Version zu teilen? Haben Sie da Tipps?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, man braucht jemanden, der eine Art Führungsrolle übernimmt. Gleichzeitig muss derjenige den anderen aber genug Freiheiten geben, um das tun, was sie wirklich gut können. Man darf sie nicht zu sehr einschränken. Man muss anderen die Möglichkeit geben, ihr Bestes zu geben.
Diese Jungs sind so begabte Musiker, die beruflich und privat guten Geschmack beweisen, und ich vertraue ihnen wirklich. Wenn man im Team arbeitet, muss man auch loslassen können. Man darf anderen nicht die Luft abschneiden oder die Kontrolle an sich reißen und sollte darauf vertrauen, dass sie ihre Arbeit gut machen. Das hilft mir, mich auf das zu konzentrieren, was ich selbst tue.
Und wie läuft das auf der Bühne ab?
Das ist viel einfacher im Team. Nachdem ich das erste Mal seit Längerem wieder mit einer Band aufgetreten bin, wurde mir erst klar, wie schwer Soloauftritte eigentlich sind.
Um 90 Minuten in Arenen, Stadien oder Festivals zu füllen, hatte ich nur mich und eine Gitarre. Und das war auf Dauer echt anstrengend, wirklich sehr anstrengend. Und es war so viel Druck. Für jedes Geräusch war ich selbst verantwortlich, musste das Publikum die ganze Zeit über allein begeistern. Mit einer Band ist es auch nicht leicht, aber man kann sich etwas zurücklehnen. Da gibt es einfach auch mal Momente, in denen man kurz durchatmen und sich sammeln kann – wie ein Gitarrensolo von Benny. Und außerdem macht es zusammen vor allem Spaß, schließlich kann auch mal miteinander herumalbern. Und diese Erfahrung gemeinsam mit anderen zu teilen, ist wirklich super.
Und hat das zu Ihrem eigenen kreativen Prozess beigetragen?
Auf jeden Fall. Ich habe die Band zusammengestellt, um Young as the Morning, Old as the Sea aufzunehmen und es war toll, eine wirklich großartige Erfahrung. Es war so intuitiv, von Beginn an so instinktiv, dass wir danach viele Konzerte zusammen gespielt haben. Dabei mussten wir nicht viel reden, wir haben einfach unsere Lieder gespielt. Frei nach dem Motto: „Das ist das Lied. So werden wir es arrangieren.“ So einfach war das. Da hat ein richtig frischer Wind geweht. Die ganze Platte aufzunehmen war eigentlich ein Kinderspiel. Für die Aufnahmen haben wir eine Woche gebraucht und innerhalb von zwei Tagen wurden sie gemischt. Wir konnten uns künstlerisch austoben, es war einfach perfekt. Eigentlich lief alles wie am Schnürchen, ohne dass wir viel darüber nachdenken mussten.
Die ganze Platte aufzunehmen war eigentlich ein Kinderspiel. Für die Aufnahmen haben wir eine Woche gebraucht und innerhalb von zwei Tagen wurde sie gemischt. Wir konnten uns künstlerisch austoben, es war einfach perfekt. Eigentlich lief alles wie am Schnürchen, ohne dass wir viel darüber nachdenken mussten.
Wenn Sie Songs schreiben, gehen Sie dabei analog vor. Sie bevorzugen Stift und Papier. Aber dann gibt es da noch diese riesige digitale Welt, die alle Ihre Fans miteinander verbindet. Was denken Sie über Technologie und die Art, wie Sie sie nutzen, um sich mit Ihrer Fangemeinde zu verknüpfen?
Als ich noch Straßenmusiker war, war ich dafür auf Facebook angewiesen, sozusagen als mein Sprachrohr nach draußen. Wenn man das, was ich gemacht habe, zehn Jahre früher versucht hätte, wäre es unglaublich schwer gewesen, Menschen zu erreichen. Mit Facebook ist alles so viel einfacher. Man denkt sich: „Ich sag einfach mal Hallo“, und schon ist man mitten im Gespräch. So habe ich meine Fangemeinde aufgebaut. Sicher hat Facebook auch Nachteile und nicht jeder ist gut drauf zu sprechen, aber für mich war es unglaublich wichtig. Ohne Facebook wäre Passenger nicht das geworden, was es heute ist. Inzwischen hat sich aber natürlich viel verändert. Ich habe leider nicht mehr die Zeit und den Freiraum, alle Nachrichten zu beantworten. Jetzt versuche ich einfach, den Menschen so viel Musik wie möglich zu geben.
Ich denke, es ist wichtig, dass man interessant bleibt. Wenn man seine eigene Ideenwelt nie verlässt, dann schreibt man einfach immer wieder ein und dasselbe Lied.
Wir machen öfter Cover Sessions. Und ich denke der Grund, weshalb Menschen den Like-Button auf meiner Seite klicken ist nicht, weil ich gut aussehe oder weil ich den Charme eines Straßenköters versprühe, sondern, weil sie wirklich Musik hören wollen. Deshalb versuche ich, ihnen so viel Musik wie möglich zu geben. Jeder nutzt Social Media anders. Ich möchte nicht einer dieser Künstler sein, die ununterbrochen Selfies posten. Leute, die Passenger mögen, sehen das sicher genauso, die Musik steht im Mittelpunkt. Selfies passen einfach nicht zu mir. Ich möchte einfach so authentisch wie möglich bleiben. Ich möchte Menschen so viel Musik und so viel Einblick wie möglich in das, was wir tun, geben.
Selbst unterwegs nehmen Sie diese Sonntags-Sessions auf. Ein Video pro Woche, nicht gerade wenig.
Ja, und das ist ganz schön anstrengend. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Es war schon ziemlich anstrengend, weil es Live-Mitschnitte sind, die wir draußen aufgenommen haben. Damals haben wir die Mikrofone und die ganze Ausrüstung in irgendeinen Wald bei eisigen Temperaturen mitgeschleppt. Junge, war das anstrengend. Das würde ich nie wieder tun. Ich freue mich natürlich, was daraus geworden ist, und ich denke, den Menschen hat es wirklich gefallen. Aber fünf Auftritte die Woche und dann das, das war einfach zu viel. Wir mussten das Lied einüben, irgendwohin fahren, den Song mit Bild und Ton aufnehmen und dann mischen. Das war ein unglaublicher Haufen Arbeit.
Wir haben jetzt etwas darüber gesprochen, wie man Kreativität wieder aufladen kann. Betrachten Sie Ihre Kreativität als etwas, das man ab und an wieder in Schwung bringen muss?
Man muss sich auf jeden Fall ausruhen.
Wenn ich ein Konzert nach dem anderen spiele, ist das körperlich einfach anstrengend. Aber egal wie ausgepowert man ist, am Ende kommen einem dann doch immer wieder neue Lieder in den Sinn. Ich weiß zwar nicht woher und wie das funktioniert, aber man muss sich auf jeden Fall ausruhen und erholen. Was auch immer in einem selbst das Zentrum für Kreativität und Musik ist: man muss ihm auf jeden Fall die Zeit geben, sich zu regenerieren.
Das schlimmste, was man tun kann ist, alles in Frage zu stellen und zu viel darüber nachzudenken. Das sind zu viele logische Fragen in einer unlogischen Situation.
Was stehen Sie zu Teamarbeit? Auf Ihrem Album Flight of the Crow sind nur Kooperationen mit anderen Künstlern zu hören, und jetzt arbeiten Sie mit einer Band zusammen. Was halten Sie insgesamt davon, etwas gemeinsam zu erschaffen?
Ich mag das. Ich denke, dass es unglaublich wichtig ist, um interessant zu bleiben. Wenn man seine eigene Ideenwelt nie verlässt, dann schreibt man immer wieder ein und dasselbe Lied. Bei jedem Projekt und jedem Album hoffe ich, dass es anders ist, als das vorangegangene. Deshalb arbeite ich auch immer mit verschiedenen Menschen zusammen, um andere Perspektiven kennenzulernen. Und wenn man an die besten Lieder, Filme oder Theaterstücke denkt – all diese Meisterstücke basieren auf Ideen von verschiedenen Menschen. Es geht immer um Zusammenarbeit oder? Das sind einfach Dinge, die ein einzelner Mensch gar nicht schaffen könnte. Und das macht das Ganze auch so aufregend, wenn viele Menschen mit Herzblut und guten Ideen dabei sind, ist das einfach großartig.
Und was können Fans von dem neuen Album erwarten?
Das neue Album ist wirklich toll. Wir haben viele Lieder aufgenommen, die ich schon vor Jahren geschrieben habe. Zum Beispiel „Setting Suns“, „I love Her“ oder der Titelsong „Boy Who Cried Wolf“. Sie sind ungefähr drei Jahre alt. Das heißt nicht, dass sie nicht gut genug sind – sie haben bisher einfach nicht zu meinen anderen Alben gepasst. Und ein paar neue Songs sind auch dabei.
Aber es geht vor allem darum, was ich vorhin bereits gesagt habe: Unbeschwertheit. Wir haben nicht zu viel darüber nachgedacht oder es zu sehr analysiert, wir haben einfach Musik gemacht. Und es sind alles Live-Mitschnitte von unserer gesamten Band, so wie wir immer spielen. Bei früheren Alben kam alles nach und nach. Ich habe meinen Part gespielt, und wenn ich ihn für gut befunden habe, musste ich warten, bis das Schlagzeug drübergelegt wurde. Und dann dachte ich: „Ja, das klingt ganz gut, jetzt müssen wir nur noch die Streicher darüberlegen“ und das ist insgesamt ein langwieriges Verfahren. Aber wenn du live spielst, es dir anhörst und direkt eine Gänsehaut bekommst, dann ist das der richtige Take. Und wenn nicht, spielst du es halt noch einmal.
Und darum sollte es bei Musik immer gehen. Das ist irgendwann in Vergessenheit geraten, und man hat angefangen, Auto-Tune zu nutzen, damit Lieder immer perfekt klingen. Und deshalb empfindet man nichts, wenn man sich solche Alben anhört, sie klingen nicht menschlich, eher nach Robotern. Und dann hört man sich ein Album von Joni Mitchell an, bei dem vielleicht nicht jede Note sitzt, aber dafür fühlt man jede einzelne davon. Wir sind natürlich nicht ansatzweise so gut wie Joni Mitchell, aber bei uns steckt die gleiche Idee dahinter. Und die ist: „Es ist nicht makellos, aber es ist echt.“ Wenn etwas von Anfang an nicht perfekt ist, erwartet man gar nicht erst, dass es perfekt wird. Das nimmt den Druck, auch wenn das etwas paradox klingen mag.
Sie wollen also Musik wieder persönlicher machen, nicht wahr? Und Menschen damit wieder richtig berühren?
Auf jeden Fall. Ich denke da an die ganzen Platten der 60er und 70er Jahre, die ich so geliebt habe. Und es ist fast, als wären die kleinen Schwächen das Beste an ihnen. Man hört ein leises Husten, oder dass ein Glass umfällt, das ist einfach so schön authentisch. Man fühlt sich in die Welt des Künstlers hineinversetzt. Irgendwann haben sich Musiker und Publikum voneinander entfernt. Das ging so weit, dass man fast denken könnte, der Künstler befände sich auf einem anderen Planeten. Und das ist nicht so, und ganz besonders nicht mit [diesem Album]. Wir wollten es so glaubhaft und ehrlich wie möglich halten.
Und jetzt steht Ihr letztes Konzert an und dann geht’s ab nach Hause, um etwas Ruhe und Erholung zu bekommen und kreative Energien zu tanken. Oder einfach um zu schlafen.
Ja, das fühlt sich ganz schön merkwürdig an. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Freizeit. Ich würde sagen nicht mehr seit 2008. Denn bevor ich „Let Her Go“ herausgebracht habe, habe ich vier oder fünf Jahre Straßenmusik gemacht und ich habe mich dabei nicht gehen lassen. Schließlich bin ich damals schon viel herumgekommen mit meiner Arbeit und war ziemlich beschäftigt. Aber der Druck ist natürlich deutlich größer geworden.
Für mich besteht meine Karriere aus drei Abschnitten: da gab es die Band, den Solo-Straßenkünstler, und dann alles, was nach „Let Her Go“ kam.
Besuchen Sie auch die Website von Passenger um zu erfahren, wie Sie sich The Boy Who Cried Wolf anhören können.
Möchten Sie noch mehr solcher Interviews lesen? Wie wäre es dann z. B. mit unserem Gespräch mit Sara Watkins oder Cindy Wilson von den B-52s.